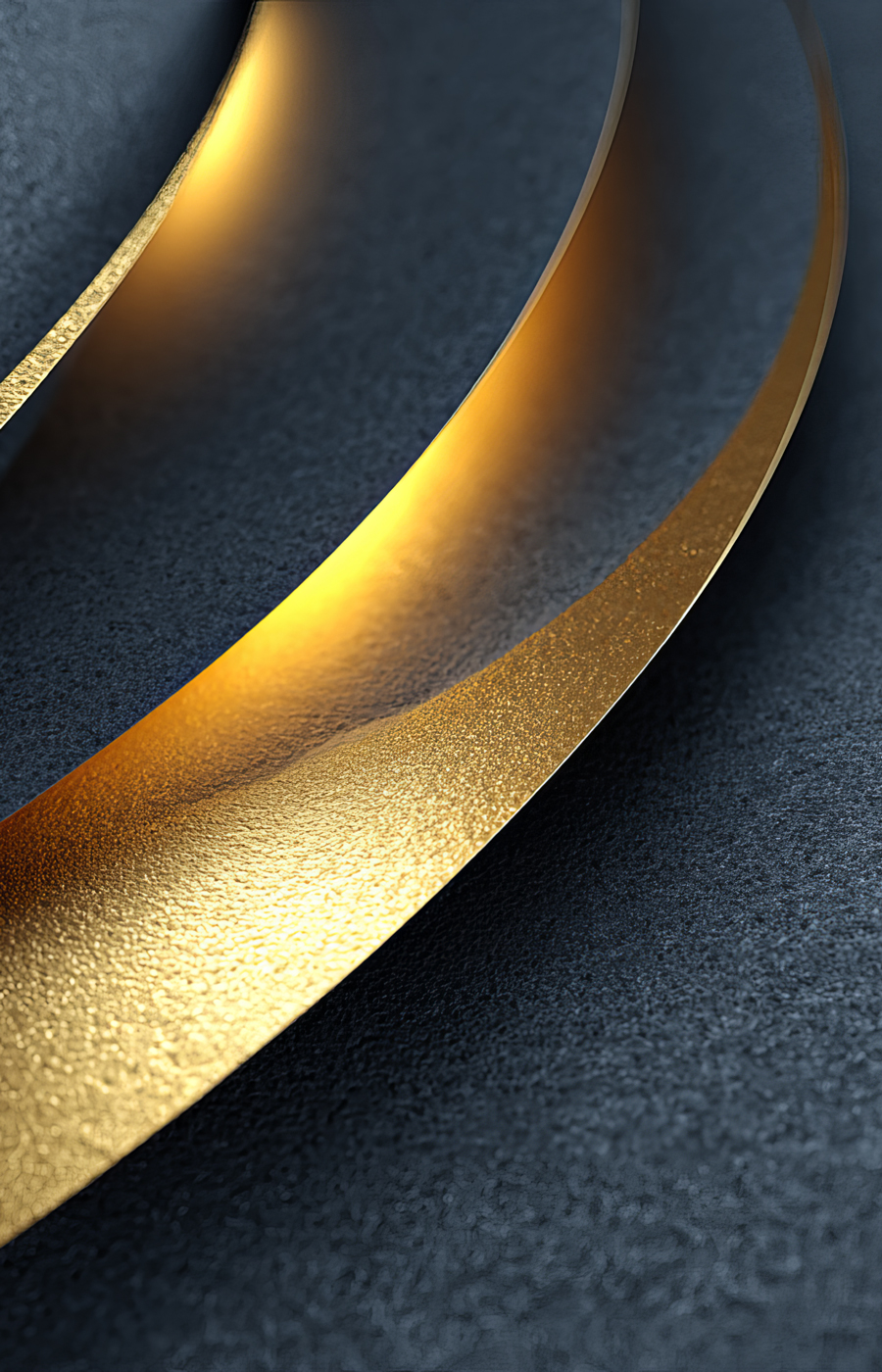Was am Ende bleibt
Immer wieder taucht sie auf: die angebliche letzte Rede von Steve Jobs. Wahrscheinlich nie von ihm gesprochen – und doch haften geblieben: „Am Ende erkennen wir, dass Reichtum und Erfolg nichts bedeuten, wenn uns niemand die Hand hält.“
Ob echt oder nicht, diese Worte wirken, weil sie zwei Wahrheiten berühren, die wir gern verdrängen: Einsamkeit und Krankheit sind Erfahrungen, die kein Geld von uns fernhalten kann.
Immer wieder taucht sie auf: die angebliche letzte Rede von Steve Jobs. Wahrscheinlich nie von ihm gesprochen – und doch haften geblieben: „Am Ende erkennen wir, dass Reichtum und Erfolg nichts bedeuten, wenn uns niemand die Hand hält.“
Ob echt oder nicht, diese Worte wirken, weil sie zwei Wahrheiten berühren, die wir gern verdrängen: Einsamkeit und Krankheit sind Erfahrungen, die kein Geld von uns fernhalten kann.
Haben, Sein – und die Grenzen des Körpers
Psychologische Studien zeigen: Geld kann Sicherheit schaffen, kurzfristig sogar Glück. Aber es hat Grenzen. Forscher der Princeton University fanden bereits 2010 heraus, dass das emotionale Wohlbefinden mit steigendem Einkommen nur bis zu einer bestimmten Schwelle zunimmt – etwa 75.000 Dollar im Jahr (heute höher angepasst). Danach steigt zwar die Lebensbewertung, aber nicht das tägliche emotionale Erleben. Geld beruhigt, aber es macht nicht dauerhaft zufrieden.
Besonders deutlich wird das im Krankheitsfall. Studien der Gesundheitspsychologie belegen, dass sozialer Rückhalt entscheidend für Heilung und Lebensqualität ist. Menschen mit stabilen Beziehungen erleben weniger Stress, haben ein stärkeres Immunsystem und erholen sich schneller – unabhängig vom Einkommen.
Auch die modernste Medizin hat eine stille Grenze. Sie operiert, verabreicht, repariert. Aber sie kann nicht trösten. Trost, Hoffnung, Sinn – das entsteht nur im Kontakt zu anderen. Nähe lindert Angst. Verbundenheit schenkt Kraft. Das ist ihr unschätzbarer Wert.
Was uns trennt – und was uns trägt
Am Ende stehen wir zwischen zwei Leeren: Erfolg entfernt uns von anderen, Krankheit entfernt uns von uns selbst. Soziologen sprechen von statusinduzierter Isolation. Doch jenseits aller Fachbegriffe bleibt die Erkenntnis: Wir sind verletzlich, endlich – und nicht alles liegt in unserer Hand. Geld kann manches lindern. Aber es schützt nicht vor der Endlichkeit.
Aristoteles nannte das gute Leben eudaimonia: nicht Besitz, sondern Entfaltung im Miteinander. Erich Fromm kritisierte unsere Kultur, die das Haben über das Sein stellt. Nirgendwo wird deutlicher, wie ungesund das ist, als im Zusammenspiel von Wohlstand, Krankheit und Einsamkeit: Wir leben länger, reicher, technisierter – und fühlen uns doch verletzlicher.
Was bleibt
Ob Steve Jobs diese Worte sprach, ist unwichtig. Entscheidend ist, dass sie uns erinnern: Reichtum schützt weder vor Krankheit noch vor Einsamkeit. Das Wertvollste, was bleibt, sind nicht Häuser, Konten, Titel. Es sind die Begegnungen, die uns halten, wenn der Körper schwach wird. Die Nähe, die uns trägt, wenn Besitz keine Antwort mehr hat.
Am Ende zählt nicht, was wir besessen haben. Sondern wie wir geliebt haben – und wie wir geliebt wurden.


 Partner werden!
Partner werden!