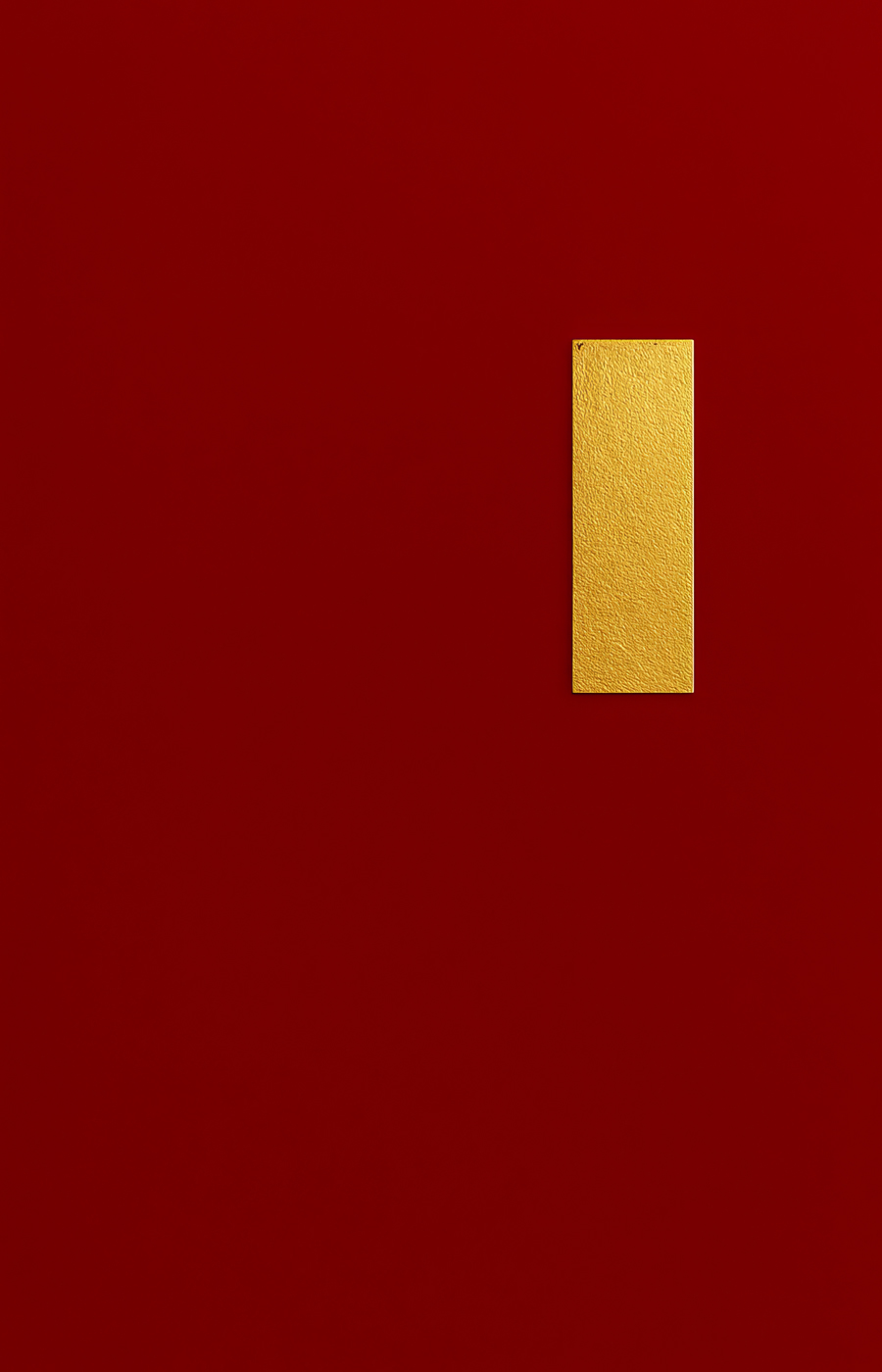Hoffnung durch neue Ansätze
Lange galt Parkinson als Erkrankung, die man zwar behandeln, aber nicht wirklich beeinflussen konnte. Doch das ändert sich. Die Forschung denkt Parkinson heute anders: als dynamischen Prozess, in den man gezielt eingreifen kann – biologisch, technologisch, systemisch.
Antikörper, Wirkstoffe aus der Diabetesforschung, bildgebende Verfahren, smarte Sensoren und digitale Caps – sie alle zeigen, wie rasant sich das Feld bewegt. Was früher wie ein Endpunkt erschien, wird heute als Anfang gedacht. Erstmals gibt es reale Ansätze, die das Fortschreiten von Parkinson nicht nur begleiten, sondern möglicherweise verlangsamen können.“
Lange galt Parkinson als Erkrankung, die man zwar behandeln, aber nicht wirklich beeinflussen konnte. Doch das ändert sich. Die Forschung denkt Parkinson heute anders: als dynamischen Prozess, in den man gezielt eingreifen kann – biologisch, technologisch, systemisch.
Antikörper, Wirkstoffe aus der Diabetesforschung, bildgebende Verfahren, smarte Sensoren und digitale Caps – sie alle zeigen, wie rasant sich das Feld bewegt. Was früher wie ein Endpunkt erschien, wird heute als Anfang gedacht. Erstmals gibt es reale Ansätze, die das Fortschreiten von Parkinson nicht nur begleiten, sondern möglicherweise verlangsamen können.“
Biomarker und Bildgebung – die Krankheit sichtbar machen
Ein zentraler Fokus der aktuellen Parkinson-Forschung liegt auf der Früherkennung. Im Mittelpunkt steht Alpha-Synuclein – ein Eiweiß, das in krankhafter Form in Nervenzellen verklumpt und dort den Abbau wichtiger Strukturen auslöst.
Erstmals gelingt es, diese veränderte Eiweißstruktur im Körper zuverlässig nachzuweisen – mit neuen Verfahren wie PMCA (Protein Misfolding Cyclic Amplification) und RT-QuIC (Real-Time Quaking-Induced Conversion).
Beide nutzen ein biochemisches Prinzip: Schon kleinste Mengen des veränderten Proteins stoßen eine Reaktionskette an, bei der sich weitere Moleküle in dieselbe krankhafte Form umwandeln. So kann das gesuchte Protein verstärkt und nachgewiesen werden – etwa in Blut, Liquor (Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit) oder Gewebeproben.
Parallel entwickeln Forschungsteams bildgebende Verfahren, die solche Ablagerungen direkt im Gehirn sichtbar machen könnten. Auch etablierte Techniken wie die Dopamintransporter-SPECT oder der transkranielle Ultraschall liefern wichtige Hinweise – vor allem im Frühstadium der Erkrankung.
WOW50 sagt: Krankheit sichtbar zu machen, bevor sie sich entfaltet, ist mehr als Diagnostik. Es ist der Versuch, dem Unsichtbaren eine Sprache zu geben – und so früher handeln zu können.
Antikörper und Impfstoffe – Moleküle als Gegner
Antikörper wie Prasinezumab sind Wirkstoffe, die gezielt an krankhaft verändertes Alpha-Synuclein binden – ein Eiweiß, das bei Parkinson verklumpt und sich im Gehirn ausbreitet. Ziel ist es, diese Ablagerungen zu neutralisieren und ihre Ausbreitung zu stoppen. Erste Studien zeigen Hinweise darauf, dass sich der Krankheitsverlauf auf diese Weise verlangsamen lässt.
Parallel wird an sogenannten aktiven Impfstoffen gearbeitet. Sie sollen das körpereigene Immunsystem trainieren, das krankhafte Eiweiß selbst zu erkennen und anzugreifen – ähnlich wie bei einer Impfung gegen Viren. Der Körper soll also lernen, sich dauerhaft selbst zu schützen.
WOW50 sagt: In der Fehlfaltung liegt die Krankheit – in der Immunantwort vielleicht die Freiheit. Forschung wird hier zur Biopolitik der kleinsten Teilchen.
GLP-1-Rezeptoragonisten – neue Chancen aus der Diabetesforschung
Ein zweiter Ansatz kommt aus einem ganz anderen Bereich: der Diabetologie.
Medikamente wie Exenatid und Lixisenatid, ursprünglich zur Senkung des Blutzuckers entwickelt, zeigen in Laborstudien auch entzündungshemmende und nervenschützende Effekte im Gehirn. Solche Wirkstoffe gehören zur Gruppe der sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten – sie beeinflussen bestimmte Signalwege, die auch bei Parkinson eine Rolle spielen könnten.
In einer großen klinischen Studie (Phase III) konnte Exenatid den Krankheitsverlauf bei Parkinson nicht signifikant beeinflussen.Lixisenatid, ein ähnlicher Wirkstoff, zeigte dagegen in einer kleineren Studie (Phase II) eine messbare Verlangsamung der Symptomverschlechterung – ein erster Hinweis auf potenzielle Wirksamkeit.
WOW50 sagt: Dass Diabetes-Medikamente plötzlich für Parkinson relevant sind, ist mehr als Pharmakologie. Es ist Wissenschaft, die neu denkt – und Zusammenhänge sieht, wo früher keine waren.
Stammzelltherapie – Ersatz statt Ergänzung
Ein neuer Ansatz rückt in den Fokus: stammzellbasierte Transplantationen. Dabei werden im Labor gezüchtete dopaminerge Vorläuferzellen – also junge Nervenzellen, die später Dopamin produzieren können – gezielt in das Striatum eingesetzt.
Das Striatum ist ein Teil der Basalganglien, einer tief im Gehirn liegenden Struktur, die maßgeblich an der Steuerung von Bewegung beteiligt ist. Genau dort fehlt bei Parkinson-Patient:innen der Botenstoff Dopamin, weil entsprechende Nervenzellen in einer anderen Hirnregion, der Substantia nigra, nach und nach absterben.
Im Gegensatz zu L-Dopa – einem Medikament, das nur die Dopaminmenge kurzfristig erhöht – sollen die transplantierten Zellen dauerhaft neue, funktionierende Nervenzellen bilden, die selbst Dopamin herstellen. Das Ziel: nicht nur Symptome lindern, sondern verlorene Hirnfunktion gezielt wiederherstellen.
Zwei Studien – aus den USA und Japan – zeigen erste Erfolge: Die transplantierten Zellen überlebten bis zu zwei Jahre, produzierten Dopamin, verbesserten die Motorik – und führten zu keinen schwerwiegenden Nebenwirkungen.
WOW50 sagt: Wenn Ersatz gelingt, wo bisher nur Kompensation möglich war, verschiebt sich die Grenze des Machbaren. Regeneration wird Realität.

„Dieser Ansatz könnte die Parkinson-Therapie revolutionieren“, sagt Prof. Dr. Lars Timmermann, Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Marburg.
Doch es gibt offene Fragen: In früheren Transplantaten wurden nach mehreren Jahren sogenannte Einschlusskörperchenbeobachtet – krankhafte Ablagerungen, die aus verklumptem Alpha-Synuclein bestehen und typisch für Parkinson sind.
Studien zeigen, dass sich dieses Protein von erkrankten auf gesunde Zellen übertragen kann – eine Art „Ansteckung“ auf zellulärer Ebene.
Ob die neu eingesetzten Zellen diesem Einfluss auf Dauer standhalten, ist noch unklar. Aber: In den bisherigen Studien funktionierten sie über zwei Jahre hinweg stabil, produzierten Dopamin und zeigten keine Anzeichen von Degeneration.
Das ist mehr als ein Signal – es ist ein realistischer Blick in eine mögliche Zukunft.
Digitale Innovationen – das Cap, das Gesichter liest
Während im Labor an Molekülen geforscht wird, entstehen in Hamburg digitale Werkzeuge für den klinischen Alltag. Ein 3D-gedrucktes Cap erkennt subtile Veränderungen in der Mimik, Smartwatches messen Bewegungsstörungen wie Tremor (Zittern) oder Dyskinesien (unwillkürliche Überbewegungen), und eine digitale „Schmerzuhr“ dokumentiert nichtmotorische Symptome wie Schmerzen oder Schlafprobleme.
Alle Daten fließen in künstliche Intelligenz-Systeme, die darin Muster erkennen – etwa Wirkfluktuationen, also Schwankungen in der Medikamentenwirkung über den Tag hinweg. So können Therapien individueller angepasst und Medikamente präziser dosiert werden. „Die Patient:innen reagieren sehr offen und neugierig auf die neuen Technologien“, sagt Priv.-Doz. Dr. Monika Pötter-Nerger. Schon heute helfen diese Systeme, den Verlauf besser zu verstehen – und schneller zu reagieren.
WOW50: Ein Cap, eine Uhr, eine App – unscheinbare Dinge, die zur Sprache der Krankheit werden. Technologie schreibt hier eine neue Grammatik des Körpers.
WOW50 Statement: Ich glaube an das, was möglich ist
Viele der neuen Ansätze sind noch in der klinischen Prüfung. Kein Durchbruch ist sicher.
Aber für mich ist klar: Wir stehen an einem Wendepunkt. Parkinson wird nicht mehr nur als eine Abfolge von Symptomen behandelt, sondern als ein Prozess, den wir verstehen, beeinflussen und vielleicht sogar verlangsamen können.
Ich sehe Hoffnung – nicht als leeres Versprechen, sondern als etwas Konkretes: In Antikörpern, die krankmachende Eiweiße blockieren. In Biomarkern, die zeigen, was früher unsichtbar war. In Algorithmen, die Muster erkennen, bevor etwas aus dem Gleichgewicht gerät.
Hoffnung liegt für mich im Wissen der Forschung, im Mut derer, die sich nicht aufgeben, und in der Ausdauer derer, die begleiten.
Ich glaube, was Ernst Bloch geschrieben hat: „Hoffnung ist die Kraft, die Zukunft als Aufgabe begreift, nicht als Schicksal.“ Und ich nehme mir zu Herzen, was Heidegger sagte: Der Mensch ist ein „Sein zum Möglichen“. Nie nur gefangen im Gegebenen – immer offen für das, was werden kann. Hoffnung ist kein Medikament. Aber vielleicht das wirksamste Mittel gegen Stillstand.
Zum Nachlesen:
Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen
Deutsche Gesellschaft für Neurologie
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf



 Partner werden!
Partner werden!